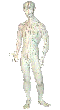| |
Matthias Weisser's alternative Medizin |
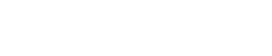 |
| Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
||
| Störfelder - gepulste Strahlung stört Gehirn, Tumoren.. |
| Literaturhinweise |
| siehe auch:
Störfelder
Handys
Gefahr-Handy
UMTS-Masten
Störfunk Gehirn
Türöffner-Effekt Mobilfunk: Fluch oder Segen Grenzwerte, Abhilfemaßnahmen grünes Dach schirmt Bürger und Politik Frequenzen |
Richard Sietmann c't 14/2000, S. 218: Elektrosmog
Störfunk fürs Gehirn
Mythos und Realität von Gesundheitsschäden durch elektronische Geräte
Kaum ein Thema ist so geeignet, die Öffentlichkeit zu polarisieren, wie die Diskussion, die unter dem Stichwort 'Elektrosmog' geführt wird. Die Schlagzeilen lauten je nach Bedarf 'Hitzkopf am Handy' oder 'Restrisiko einer Pudelmütze'. Wann immer es um die elektromagnetische Umweltverträglichkeit (EMVU) geht, bewegt sich die Diskussion zwischen Hysterie und Bagatellisierung.Das Thema Elektrosmog taucht in unregelmäßigen Abständen immer wieder in den Medien auf. Einmal prunkt ein Bericht mit dem vermeintlichen Beweis, die elektromagnetischen Felder moderner Hightech-Geräte seien gesundheitsschädlich; ein anderes Mal wieder führt ein Artikel den angeblich unschlagbaren Nachweis, das sei alles Quatsch und nichts so ungefährlich wie ein Handy.
Grund zur Besorgnis gibt die lawinenartige Vermehrung von Strahlungsquellen elektromagnetischer Felder jedenfalls vielen Mitmenschen: Mikrowellenherde, Mobil- und Schnurlostelefone, Babyfone, Einbruchsicherungen, Fernsehgeräte und Computer-Monitore gehören zur Grundausstattung in den Haushalten; im öffentlichen Raum strahlen Rundfunk- und Fernsehsender, Wireless Local Loops als Direktanbindung der Telefonkunden über Funk, Funkfeuer für die Flugsicherung, Richtfunk- und Radaranlagen.
Selbst die Sonne - wichtigste natürliche Quelle - trägt zu dem bei, was gemeinhin als 'Elektrosmog' bezeichnet wird: Sie wirft neben dem sichtbaren Licht und den angrenzenden infraroten und ultravioletten Spektralanteilen auch hochfrequente Strahlung im Bereich von 3 bis 300 GHz auf die Erde, dies allerdings mit der sehr geringer Intensität von weniger als 10 Mikrowatt pro Quadratmeter (µW/m2). Die 'Grundkonzentration' der Emission von Haushaltsgeräten bewegt sich vergleichsweise in der Größenordnung von einigen Dutzend µW/m2 und liegt damit nach heutigem Erkenntnisstand im grünen Bereich.
Dies gilt aber eigentlich nur für die Betrachtung eines einzelnen Geräts. Stein des Anstoßes ist der flächendeckende Ausbau des Mobilfunks, der zudem aus Wettbewerbsgründen in Mehrfachnetzen mit Sendeanlagen konkurrierender Betreiber erfolgt. Deren Basisstationen überdecken insbesondere dicht besiedelte Regionen feinmaschig mit Abständen bis hinunter zu hundert Metern und funken in den Frequenzbereichen 905 bis 959 MHz (GSM-900, D-Netz) und 1710 bis 1880 MHz (DCS-1800, E-Netz). Anders als die ebenfalls flächen-deckende Versorgung der UKW- und Fernsehsender, deren Sendetürme im Abstand von einigen zehn Kilometern Leistungen von bis zu 500 000 Watt im Frequenzbereich 86 bis 107 MHz (UKW) und 170 bis 600 MHz (VHF, UHF) abstrahlen und in der unmittelbaren Umgebung zu einer starken Exposition der Bevölkerung mit elektromagnetischen Feldern führen (die Feldstärke nimmt umgekehrt proportional mit der Entfernung ab), stützt sich der Mobilfunk auf viele kleine Funkzellen mit schwachen Sendern. Die Sendeleistung der Basisstationen liegt zwischen fünf und 40 Watt, die der Handys bei zwei Watt (GSM-900) beziehungsweise 0,5 W (DCS-1800).
Das Spektrum von Geräten der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, die unter Elektrosmog-Verdacht stehen, liegt im Frequenzbereich von 1 MHz bis 10 GHz.
Und die Mobilfunk-Industrie setzt zurzeit alles daran, auf Wachstumskurs zu bleiben. Inzwischen wird auch die 2,45-GHz-Funkanbindung von Peripheriegeräten an Computer im so genannten ISM-Band via Bluetooth als Alternative zum Kabelsalat langsam realistisch. Glänzende Prognosen gibt es auch für die Wireless Local Loops (WLL) und die Wireless Local Area Networks (WLAN), die sich sukzessive die Frequenzbereiche um 5,2, 17, 19, 26, 48, 40 und 60 GHz erschließen, um damit Daten mit Raten von 25, 155 und 622 MBit/s an stationäre und mobile Endgeräte übertragen zu können.
Strahlungsdichte
Aus einer in den USA durchgeführten Studie geht hervor, dass in größeren Städten die durchschnittliche Hintergrundstrahlung etwa 50 µW/m2 beträgt; aber rund ein Prozent der Bevölkerung lebt in Großstädten, wo sie mit mehr als 10 000 µW/m2 einer über 200-mal stärkeren Leistungsflussdichte - also Strahlungsleistung pro durchsetzter Flächeneinheit - ausgesetzt ist. Doch auch dieser Wert bleibt noch weit jenseits bislang nachweisbarer Wirkungen auf den menschlichen Organismus.Nach der herrschenden Meinung sind für die hochfrequenten Felder nur thermische Wirkungen auf den menschlichen Organismus wissenschaftlich einwandfrei belegt. Die Kurz- und Mikrowellentherapie nutzt sie sogar zur Heilbehandlung aus; dort lindert die Durchwärmung gezielt bestrahlter Körperstellen rheumatische Leiden, Entzündungen und Abszesse.
Um Humangewebe um ein Grad Celsius zu erwärmen - diese Temperaturerhöhung gilt als gesundheitlich unbedenklich, weil sie im Bereich normaler physiologischer Schwankungen bleibt -, braucht es Leistungsdichten um 100 Millionen µW/m2. Ausschließlich an den thermischen Wirkungen auf biologisches Gewebe orientieren sich auch die geltenden Grenzwerte. Um die Erwärmung des Körpers auf höchstens 0,1 Grad zu begrenzen, legt die 26. Bundesimmissionsschutz-Verordnung (BImSchVO) die höchstzulässigen mittleren Leistungsdichten für das GSM-900-Netz auf 4,5 Millionen, für das DCS-1800-Netz auf 10 Millionen µW/m2 fest; dies entspricht maximalen elektrischen Feldstärken von 42 beziehungsweise 58 V/m.
Ionisierende und nicht-ionisierende Strahlung hat je nach Frequenzbereich unterschiedliche Auswirkungen - wobei sich die diversen wissenschaftlichen Studien in der Relevanz möglicher Nebenwirkungen elektromagnetischer Felder stark unterscheiden.
Wie die meisten Länder folgt die Bundesrepublik damit den Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutz-Kommission für Nicht-Ionisierende Strahlen (ICNIRP) [1], die wissenschaftlich basierte Richtlinien und Grenzwerte erarbeitet und als nicht-regierungsamtliche Vereinigung förmlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannt ist.
Grenz- und Schwellwerte
Da die Immission selbst noch nichts über die Wirkung auf den menschlichen Organismus aussagt, ist sie nur mittelbar ein Maß für die tatsächliche Exposition. Entscheidend ist, wie der Körper die Einstrahlung absorbiert und die aufgenommene Energie verarbeitet. Diese Vorgänge werden durch die spezifische Absorptionsrate (SAR) charakterisiert, die aufgenommene Leistung pro Kilogramm Körpermasse. Der Immission von 100 Millionen µW/m2, die in biologischem Gewebe zu einer Temperaturerhöhung von ein Grad Celsius führen kann, liegt eine SAR von 4 W/kg zu Grunde.Mit einem Sicherheitsfaktor 10 wurde als Grenzwert für beruflich exponierte Personen ein SAR-Wert von 0,4 W/kg definiert; für die allgemeine Bevölkerung empfiehlt ICNIRP, mit einem zusätzlichen Sicherheitsfaktor 5 die SAR auf 0,08 W/kg zu begrenzen. An diesen Vorgaben orientieren sich die nationalen Strahlenschutzbehörden der meisten Länder bei der Herleitung der frequenzabhängigen Feldstärke- oder Leistungsdichte-Grenzwerte, die sich in der Praxis leichter messen lassen als der SAR-Wert.
Grenzwerte sind, selbst wenn sie sich aus komplizierten Formeln ableiten, eine politische Übereinkunft. Sie definieren einen Sicherheitsabstand zu wissenschaftlich anerkannten Wirkungsschwellen. Damit markieren sie, wie es ein Kenner der Materie einmal treffend ausdrückte, nicht unbedingt die Schwelle der Gefährdung, sondern die des Gerichtssaales: Ein Überschreiten muss nicht unmittelbare gesundheitliche Schäden nach sich ziehen; es bietet Betroffenen aber rechtlich eine Handhabe, gegen den Verursacher vorzugehen.
Wissenschaftlich anerkannt sind bislang ausschließlich die thermischen Wirkungen hochfrequenter Felder. Grenzwerte stützen sich auf bekannte Effekte; ungesicherte Erkenntnisse oder das Risiko des Nichtwissens berücksichtigen sie nicht. Für vermutete Gefährdungen tragen - im Juristendeutsch - die Betroffenen die Beweislast, nicht der Zustandsstörer. Eine Umkehrung der Beweislast erscheint kaum denkbar. Sonst müssten, da Nulleffekte nicht beweisbar sind, die Betreiber ihre Anlagen stilllegen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Mobilfunk-Strahlung nicht von den materiellen Immissionen ökotoxischer Chemikalien in Wasser, Luft und Boden: Jede Festlegung von Grenzwerten ist mit einer Risikozumutung verbunden und der Fortschritt bleibt ein andauerndes Experiment mit der Gesellschaft.
Messaktionen
Als Reaktion auf die wachsende Besorgnis der Öffentlichkeit ließ das österreichische Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr im vergangenen Jahr an sieben Standorten Expositionsmessungen der Felder aus UKW- und Fernsehsendern sowie Mobilfunk-Basisstationen durchführen [2]. Die österreichische Norm S 1120 legt je nach Frequenz Grenzwerte zwischen 1 und 10 Millionen µW/m2 fest; die ermittelten maximalen Leistungsdichten der UKW-, VHF- und UHF-Sender erreichten 93 µW/m2; die höchste gemessene Leistungsdichte einer Mobilfunk-Anlage betrug 856 µW/m2.Bei diesem Fall handelte es sich um ein Firmengebäude, an dessen Fassade sich eine GSM-900-Antenne befand; der gemessene Wert trat bei 909 MHz auf. In demselben Firmengebäude lieferte die breitbandige Messung in dem gesamten Spektralbereich von 30 MHz bis 1 GHz allerdings einen sechsfach höheren Wert von 5198 µW/m2, der zwar auch nur 0,26 Prozent des geltenden Grenzwerts ausmacht, aber doch immerhin zeigt, wie sehr sich unter Umständen die Exposition aus verschiedenen Quellen aufsummieren kann.
Bei der Auswertung der Messungen kam der Biophysiker Jiri Silny, Professor am Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik der RWTH Aachen, zu dem Schluss, dass die relevanten Leistungsflussdichten einen Faktor 1000 unter den international anerkannten Grenzwerten blieben. 'Im Allgemeinen werden diese Werte insbesondere in Wohnungen auch in der unmittelbaren Nähe von Wohnanlagen oder in Räumlichkeiten, die sich unterhalb der Antenne befinden, deutlich unterschritten', so das Fazit der Studie. Die typischen Werte von Wohnungen in der Nähe von Basisstationen lagen bei 20 µW/m2, einem Bruchteil von Promille des geltenden Grenzwerts. 'Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch derart schwache Felder konnte bisher nicht aufgezeigt werden', heißt es daher.
In der Bundesrepublik führt die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) seit 1992 in periodischen Abständen von vier Jahren bundesweite EMVU-Messaktionen durch. Das Monitoring soll sicher stellen, dass mit der Errichtung immer neuer Sendeanlagen das Fass nicht überläuft und irgendwann die höchstzulässigen Personenschutzwerte überschritten werden. Dazu werden an rund 1250 Messorten - hauptsächlich in Bereichen von allgemein zugänglichen Straßen, Plätzen und Anlagen sowie Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern - die vor Ort auftretenden Feldstärken ermittelt und ins Verhältnis zu den geltenden Grenzwerten gesetzt.
Wurden 1992 die Immissionen im Frequenzbereich von 10 kHz bis 1 GHz gemessen, so dehnte die RegTP bei der zweiten Messreihe 1996/97 diesen Bereich auf 10 kHz bis 2,9 GHz aus, um auch die neu hinzugekommenen Mobilfunk-Dienste insbesondere der E-Netze mit erfassen zu können. In der derzeit laufenden Messaktion 1999/2000 wurde das Spektrum nochmals erweitert und umfasst nun in zwei überlappenden Teilen die niederfrequenten (1 Hz bis 10 MHz) und die hochfrequenten (100 kHz bis 300 GHz) Felder. Die Auswertung soll noch im Laufe dieses Halbjahres abgeschlossen und dann im Internet veröffentlicht werden; Tabellen mit ersten Ergebnissen für die einzelnen Bundesländer sind dort bereits zu finden [3].
Die ersten beiden Messreihen legten der Bewertung noch die Grenzwerte der Norm DIN VDE 0848 Teil 2 vom Oktober 1991 zu Grunde. Die derzeitige Messreihe beruht im Einklang mit der BImSchVO und der EU-Empfehlung 1999/519/EG vom Juli letzten Jahres auf den ICNIRP-Richtlinien. Allerdings lassen sich auf Grund der Umstellung die neuen Messergebnisse nicht mit den früheren vergleichen und erlauben somit auch keine Rückschlüsse auf die zeitliche Entwicklung der Immissionen an einem bestimmten Messpunkt; Aussagen, ob an einzelnen Standorten eine Zunahme oder Abnahme des Feldstärkeniveaus erkennbar ist, sind somit nicht möglich.
Ein echter Verlust an Information ist das nicht, denn selbst die jetzt im Frequenzbereich von 100 kHz bis 300 GHz ermittelten Höchstwerte bewegen sich noch im Promillebereich des maximal zulässigen Wertes. In Berlin beispielsweise ergab sich als höchster Messwert 0,6 Prozent, als niedrigster 0,01 Prozent des Grenzwerts; in Nordrhein-Westfalen lag die Spanne zwischen 0,8 Prozent und 0,002 Prozent.
Hitzköpfig
Sowohl die österreichische als auch die bundesdeutsche Messaktion, die übereinstimmend die aktuell verhältnismäßig geringe Belastung der Allgemeinbevölkerung aufzeigen, beschränkten sich auf die Erfassung der von ortsfesten Sendeanlagen hervorgerufenen Immissionen. Die Wirkung der Handys auf die Mobilfunk-Teilnehmer selbst war nicht Gegenstand der Untersuchungen.'Wenn überhaupt eine Beeinflussung vorliegt, dann würde ich sie primär von den Handys erwarten', meint Silny; 'die Exposition durch Handys ist ja Faktor 1000 bis 10 000 stärker als die durch Basisstationen'. Typische SAR-Werte der Mobiltelefone liegen zwischen 0,2 und 0,4 W/kg. Die Streuung ist jedoch wesentlich größer und reicht von 0,02 bis 1 W/kg.
Der Grund für diese Spannbreite ist nicht nur in den Konstruktionsunterschieden der Hersteller zu finden, sondern liegt teilweise auch an der Art der Messung und den dazu herangezogenen Kopf- und Absorptionsmodellen. Im ungünstigsten Fall, und wenn das Gerät bei schwierigen Empfangsbedingungen mit voller Leistung strahlt, kann sich das Kopfgewebe folglich um einige zehntel Grad erwärmen, ein Effekt, den Spötter mit dem Aufsetzen einer Pudelmütze vergleichen.
Aber sind die thermischen Wirkungen, auf denen gegenwärtig die Grenzwertfestsetzungen beruhen, tatsächlich die einzigen? Die herrschende Meinung geht davon aus, dass nicht-ionisierende Strahlung bei geringer Intensität harmlos ist und nachweisbare Wirkungen erst ab einem Schwellwert bei einer bestimmten Mindestfeldstärke eintreten. Im Unterschied zu Röntgen- und Gammastrahlen sind die hochfrequenten elektromagnetischen Felder viel zu schwach, um die Bindungen, die die Moleküle in den Zellen zusammenhalten, aufzubrechen und biologisches Gewebe - etwa die DNS im Zellkern - durch Ionisierung zu schädigen. Zu dieser Aufspaltung ist mindestens eine Strahlungsenergie von einigen Elektronenvolt (eV) nötig; die 1-eV-Grenze liegt im ultravioletten Teil des Spektrums. Davon ist die Energie der Strahlungsquanten von Mobilfunk-Wellen - sie beträgt 4 µeV bei 0,9 GHz und 7 µeV bei 1,8 GHz - etwa um den Faktor 10-6 entfernt.
Wenn es also nicht-thermische Effekte und 'low-level radiation hazards' der nicht-ionisierenden Strahlung geben sollte, müssen sie auf anderen Wechselwirkungsmechanismen beruhen. Die Komplexität der medizinischen und physikalischen Zusammenhänge lässt hier ein weites Feld für Interpretation und Spekulation. Für Aufsehen sorgten beispielsweise zwei Arbeiten, in denen 1992 der amerikanische Biologe Robert Liburdy über den Einfluss elektromagnetischer Felder auf die Kalziumionen-Mobilität in Zellen berichtete. Da Kalziumionen eine wichtige Rolle bei der Zellteilung spielen und das Wachstum von Tumoren wiederum mit der Zellvermehrung zusammenhängt, begründeten sie erstmals den Verdacht, dass nicht-ionisierende Strahlung krebsfördernd sein könnte. Das klang plausibel, und entsprechend genau wurden die Arbeiten von den Fachkollegen gewürdigt. Die Resultate ließen sich jedoch nicht reproduzieren; Unstimmigkeiten legten vielmehr den Verdacht nahe, dass die experimentellen Ergebnisse manipuliert waren. Nach einem langwierigen Verfahren wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens zog der Autor im vergangenen Jahr beide Veröffentlichungen zurück.
'Es gibt wenige Fachgebiete', meint Jiri Silny, 'die derart mit theoretischen Ansätzen, spekulativen Denkmodellen, unbewiesenen Hypothesen oder Theorien, aber auch mit Aberglauben durchsetzt sind'. In den letzten 30 Jahren sind rund 25 000 Fachveröffentlichungen zum Thema erschienen. Rund 3000 hat Silny zurzeit in einer Datenbank erfasst, mit der er für mehr Transparenz sorgen will [4].
Das Überangebot an Information verschleiert eher, wie wenig man wirklich weiß. In der emotional aufgeladenen Debatte beschränken sich die meisten Wissenschaftler lieber auf die Generierung von Mikrowissen und scheuen vor zusammenhängenden Bewertungen zurück. Da heißt es dann etwa in einer Untersuchung zur Bestrahlung von Fadenwürmern mit 750-MHz-Mikrowellen, die Resultate 'deuten darauf hin, dass die derzeitigen Expositionsgrenzwerte möglicherweise überprüft werden müssen', denn ähnliche Effekte wie die beobachteten 'könnten unter Mikrowelleneinfluss auch in menschlichem Gewebe auftreten, eine Möglichkeit, die weiterer Untersuchungen bedarf' [5].
'Möglicherweise', 'könnten', 'deuten darauf hin' - Wissenschaftler sind aus guten Gründen vorsichtig in ihrer Wortwahl. Da es in der Biologie und Medizin nicht möglich ist, Nulleffekte zu beweisen, kann sich die Zunft der Angelegenheit nur mit Trial and Error nähern, indem sie Hypothesen über vermutete oder verdächtigte Wirkungsmechanismen aufstellt und dann versucht, diese in experimentellen Simulationen oder epidemiologischen Studien zu verifizieren. Unterdessen ruft das Publikum auf den Rängen 'Bravo' oder 'Schiebung', je nachdem, welche Interessen oder Vorurteile von der neuesten Untersuchung gerade bedient werden. Schon wird die ganze Veranstaltung diskreditiert mit der Unterstellung, die Forscher würden höchst eigennützig Ängste und Befürchtungen schüren und etwaige Gefährdungen und Risiken bewusst dramatisieren, um darzulegen, wie dringend es weiterer Forschungen und Fördermittel bedürfe.
Doch so einfach lässt sich die Diskussion um die 'low-level radiation hazards' nicht beerdigen. Es gibt durchaus ernst zu nehmende Hinweise auf nicht-thermische Wirkungen hochfrequenter, elektromagnetischer Felder geringer Intensität. Die zellbiologische Untersuchung der Forscher von der Universität Nottingham und der kanadischen University of British Columbia an den Fadenwürmern beispielsweise zeigte, dass die bestrahlten Würmer so genannte Hitzeschock-Proteine produzierten. Diese speziellen Eiweiße agieren als molekularer Schutz zur Rettung von Zellproteinen, wenn ein Organismus von Wärme oder toxischen Stoffen angegriffen wird.
Aber in diesem Fall war keine Wärme im Spiel. Die spezifische Absorptionsrate betrug nur 1000 µW/kg - war also deutlich geringer als die 200 000 bis 400 000 µW/kg handelsüblicher Handys - und die Körpertemperatur der Tiere in den Proben blieb gleich. Um denselben Effekt auf thermischem Wege zu erzielen, hätte sie mindestens um drei Grad ansteigen müssen. Dass die Versuche an Fadenwürmern durchgeführt wurden, ist nicht unbedingt beruhigend: Die Hitze-Schock-Reaktion ist ein universeller Mechanismus, mit dem auch menschliche Körperzellen entsprechende Eiweiße ausschütten, wenn sie unter Stress geraten.
Restrisiko?
Epidemiologische Auffälligkeiten zwischen der Handy-Nutzung und der Häufigkeit von Krebserkrankungen sind bisher nicht beobachtet worden. Aber da Tumore mehrere Jahre zur Entwicklung benötigen, lässt sich daraus noch nichts ableiten. Um Langzeitwirkungen herauszufinden, müssen so genannte Fall-Kontroll-Studien an Erkrankten und Gesunden nicht nur ein Nutzungsverhalten erfassen, das etwa fünf bis zehn Jahre zurückliegt - also in die Frühphase des Mobilfunk-Booms fällt -, sondern es auch noch von anderen Krebs auslösenden Faktoren statistisch signifikant abgrenzen können. Immerhin: Schon der geringe Anstieg der Krebswahrscheinlichkeit um ein Promille würde unter den derzeit rund einer halben Milliarde Handy-Nutzern weltweit 500 000 Tumorerkrankungen zusätzlich bedeuten.Aufschluss über derartige Langzeit-Risiken soll das 1996 von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufene Internationale EMF-Projekt liefern [6]. Im Rahmen dieses Projektes organisiert derzeit das in Lyon ansässige Internationale Krebsforschungszentrum (IARC) Fall-Kontroll-Studien an mehr als 6000 Probanden in Deutschland, Frankreich, England, den Vereinigten Staaten und neun weiteren Ländern. Nach dem Abschluss der rund zwölf Millionen Mark teuren Erhebung - erste Ergebnisse sind in drei bis vier Jahren zu erwarten - lässt sich dann vielleicht die Frage beantworten, ob die Exposition mit niedrigdosierten HF-Feldern mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden ist.
Neben den klinischen Untersuchungen hat sich das noch bis zum Jahre 2005 laufende WHO-Vorhaben die Koordinierung der Forschungsaktivitäten und die Vereinheitlichung der oftmals nicht vergleichbaren Messmethoden und Auswerteverfahren zum Ziel gesetzt. Angeschlossen haben sich rund 40 Staaten sowie eine Reihe internationaler Organisationen. Die konkreten Arbeiten führen die Internationale Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) und weitere Einrichtungen, die mit der WHO auf wissenschaftlicher Ebene zusammenarbeiten, durch. Dazu zählen das National Radiological Protection Board (England), das Bundesamt für Strahlenschutz (Deutschland), das Karolinska Institut (Schweden), das Nationale Institut für Umweltforschung (Japan) sowie die Food and Drug Administration, das National Institute of Environmental Health Sciences und das National Institute of Occupational Safety and Health in den USA.
Geleitet wird das internationale EMF-Projekt von Michael Repacholi. Der Australier hat einen Wandel vom Paulus zum Saulus durchgemacht. Ursprünglich war er selbst von der Unbedenklichkeit der Handy-Emissionen überzeugt - bis er eigene Untersuchungen anstellte. Mit seinem Team am Royal Adelaide Hospital setzte er Labormäuse, das Modellsystem der Biomediziner, mit einer SAR von 0,008 bis 4,2 W/kg über 18 Monate täglich eine Stunde lang den gepulsten 900-MHz-Feldern eines GSM-Mobilfunk-Handys aus. Dabei stellte sich heraus, dass in der bestrahlten Gruppe Geschwülste der Lymphknoten - so genannte Lymphome - doppelt so häufig auftraten wie in der unbestrahlten Kontrollgruppe.
Repacholi hatte die Arbeit zunächst beim Wissenschaftsmagazin Science eingereicht, das die Veröffentlichung jedoch mit der Begründung ablehnte, derartig folgenschwere Ergebnisse könnten eine Panik hervorrufen und müssten erst durch ein unabhängiges Team verifiziert werden. Nature und drei weitere einschlägige Fachzeitschriften lehnten die Publikation ebenfalls ab, bis sie dann 1997 in Radiation Research erschien [7]. In Australien und Europa bemühen sich gegenwärtig Forschergruppen, Repacholis Ergebnisse zu reproduzieren; selbst wenn sich die Ergebnisse bestätigen sollten, bliebe noch die Frage der Übertragbarkeit auf den Menschen zu klären. Bis auf weiteres jedenfalls müssen Handy-User mit der Ungewissheit leben.
Unbequeme Experten
Die bislang umfassendste Bestandsaufnahme und Bewertung der Erkenntnisse zu den Gesundheitsrisiken der Mobiltelefonie legte im Mai des Jahres die Independent Expert Group on Mobile Phones (IEGMP) in England vor, wo der Mobilfunk-Boom von rund 175 lokalen und landesweiten Bürgerinitiativen kritisch begleitet wird. Die von Sir William Stewart von der Royal Society geleitete Expertengruppe setzte sich aus ausgewiesenen Biologen, Medizinern, Epidemiologen, Physikern und Nachrichtentechnikern zusammen und war im vergangenen Jahr vom britischen Gesundheitsministerium einberufen worden - ein deutlicher Affront gegen die Nationale Strahlenschutzbehörde NRPB und deren eigenen wissenschaftlichen Beirat zu den Fragen der nicht-ionisierenden Strahlung.Zusammengefasst kommen die Briten in ihrem Report 'Mobile Phones and Health' zu folgenden Ergebnissen:
- Im Umfeld von Basisstationen, wo die Exposition weit unter den Grenzwerten bleibt, besteht kein allgemeines gesundheitliches Risiko für die dort lebende Bevölkerung.
- Es gibt jedoch deutliche Anzeichen, dass die Exposition der Handy-Nutzer durch Strahlung mit Intensitäten unterhalb der gültigen ICNIRP-Grenzwerte direkte, kurzfristige Einflüsse auf die Hirnstromaktivitäten und die kognitiven Funktionen des Gehirns hat. 'Es besteht ein dringender Bedarf herauszufinden, ob diese direkten Auswirkungen auf das Gehirn gesundheitliche Folgen haben, weil dann die Expositionsgrenzwerte neu festgelegt werden müssen, sofern sich dafür ein Schwellwert angeben lässt.' Wichtig sei die Klärung der Frage, ob die beobachteten Effekte eine Folge der lokalen Erwärmung sind oder auf anderen, nicht-thermischen Mechanismen beruhen.
- Die derzeit verfügbaren epidemiologischen und biologischen Erkenntnisse lassen nicht den Schluss zu, dass die Exposition mit hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung das Risiko für Krebserkrankungen erhöht. 'Mobiltelefone sind jedoch noch nicht lange genug im Gebrauch, um eine umfassende epidemiologische Erfassung ihrer gesundheitlichen Auswirkungen zu erlauben, und wir können zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es eine Verbindung zwischen der Mobilfunk-Technik und Krebs gibt.'
- Untersuchungen an Zellen und Tieren deuten nicht darauf hin, dass die Mobilfunk-Strahlung im Rahmen der festgelegten Grenzwerte schädigende Einflüsse auf das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem oder die Fortpflanzung haben. Selbst eine langandauernde Exposition scheint die Lebenserwartung nicht zu beeinflussen. Auch die derzeit noch begrenzten epidemiologischen Erkenntnisse geben diesbezüglich keinen Anlass zu Besorgnis.
Von den Mobilfunk-Betreibern erwarten die Experten, dass sie Kinder als Zielgruppe von ihren Marketingaktivitäten ausnehmen, weil diese auf Grund ihrer dünneren Schädeldecke und des sich noch entwickelnden Nervensystems einem größeren Risiko ausgesetzt sind. Die Handy-Hersteller werden aufgefordert, sich auf standardisierte Testverfahren der Strahlenbelastung zu verständigen und die SAR-Werte auf den Endgeräten anzugeben; nach dem Vorbild der Verbrauchswerte von Kraftfahrzeugen sollten die Ergebnisse solcher Vergleichstests öffentlich leicht zugänglich sein, damit die Konsumenten bewusstere Kaufentscheidungen treffen können.
Besonders kritisch setzt sich die IEGMP mit der Politik und den von ihr geschaffenen, speziellen Rahmenbedingungen der Planung und der Standortwahl für die Basisstationen auseinander, die ohne ein förmliches Genehmigungsverfahren auch in Wohngebieten errichtet werden können: 'Wir betrachten dies als unakzeptabel.'
Ohne Beteiligung
Die quasi genehmigungsfreien Installationspraktiken in England unterscheiden sich nicht von denen in der Bundesrepublik. Im Rahmen des mit der Lizenz erworbenen Versorgungsauftrags sind die Mobilfunk-Betreiber lediglich anzeigepflichtig und müssen nur eine Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde vorweisen können, dass der Betrieb der Basisstation die festgelegten Grenzwerte einhält. Ein Genehmigungsverfahren ist mit dem Errichten nicht verbunden, einzig mit den Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer müssen sie verhandeln und sich mit ihm über die Konditionen einigen.Ein öffentlich zugängliches Kataster mit den Standorten und Emissionsdaten der 'ortsfesten Sendeanlagen' gibt es ebenfalls nicht. Vom Gesetzgeber verlangt die IEGMP nun, die pauschale Betriebsgenehmigung zu widerrufen und die Errichtung neuer wie auch die Erweiterung bestehender Basisstationen den normalen Antrags- und Genehmigungsverfahren zu unterwerfen. Genau dies hatten die Sonderrechte für Mobilfunk-Betreiber vermeiden wollen, weil diese wie der Teufel das Weihwasser die Einsprüche der Betroffenen fürchteten.
Dabei könnten sie denen recht gelassen entgegensehen. Denn nach dem derzeitigen Kenntnisstand, so stellen auch die kritischen Briten fest, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Exposition mit hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung unterhalb der ICNIRP-Richtwerte eine Gesundheitsgefährdung der Allgemeinbevölkerung darstellt. Verglichen mit anderen Risiken des Alltagslebens - etwa dem Blutzoll des Straßenverkehrs, der in der Bundesrepublik Jahr für Jahr die Bevölkerung einer Kleinstadt ausrottet und die Einwohnerzahl einer Stadt wie Hannover schwer verletzt - mutet die Gefährdung durch die Mobilkommunikation noch relativ harmlos an.
Richtig schlimm wird es nur, wenn beim Handy-Quasseln am Lenkrad beides zusammentrifft und das erhöhte Risiko dann Verursacher und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gleichermaßen trifft. Ob mit Handapparat, Ohr-Clip oder Freisprecheinrichtung telefoniert wird, macht Untersuchungen zufolge keinen Unterschied; die Gefährdung geht auch nicht von den Mobilfunk-Wellen aus, sondern ist - darin sind sich die britischen Experten 'fast sicher' - der Ablenkung durch das Gespräch selbst zuzuschreiben. (jk)
Literatur
[1] Internationale Strahlenschutz-Kommission für Nicht-Ionisierende Strahlen, www.icnirp.de
[2] Jiri Silny, Exposition der Allgemeinbevölkerung durch hochfrequente elektromagnetische Felder - Plausibilität der gesundheitlichen Unbedenklichkeit, September 1999, www.bmv.gv.at
[3] Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post www.regtp.de
[4] Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik der RWTH Aachen, Studien über Elektrosmog www.femu.rwth-aachen.de
[5] Nature 417, 405 (2000)
[6] Internationale EMF-Projekt der Weltgesundheitsorganisation, www.who.ch/emf
[7] Radiation Research 631, 147 (1997)
[8] Independent Expert Group on Mobile Phones, Mobile Phones and Health www.iegmp.org.uk/IEGMPtxt.htm
Immissionsgrenzwerte der Mobilfunk-Systeme
| GSM-900 | DCS-1800 | |
| elektrische Feldstärke | 42 V/m | 58 V/m |
| magnetische Feldstärke | 0,13 A/m | 0,157 A/m |
| mittlere Leistungsdichte | 4,5 W/m2 | 10 W/m2 |
Dosimetrie
Im Unterschied zu Röntgen- und Gammastrahlen sind die hochfrequenten elektromagnetischen Felder nicht energiereich genug, um die Bindungskräfte der Moleküle in den Zellen aufbrechen zu können und auf diese Weise eine Ionisierung zu verursachen. Sie werden deshalb auch als nicht-ionisierende Strahlung bezeichnet. Von ihr wird angenommen, dass sie bei geringer Intensität harmlos ist und erst bei hohen Intensitäten Gewebeschäden verursacht. Sie kann jedoch unterschiedliche Wirkungen auf biologische Systeme - Zellen, Pflanzen, Tiere oder Menschen - entfalten, die von der Frequenz und Intensität abhängen.- HF-Felder über 10 GHz werden an der Hautoberfläche absorbiert, wobei nur ein sehr geringer Teil der Energie in das darunter liegende Gewebe eindringt. Die dosimetrische Grundgröße in diesem Frequenzbereich ist die Leistungsflussdichte in W/m2.
- Felder zwischen 1 MHz und 10 GHz dringen in exponierte Gewebe ein und erwärmen diese durch Energieabsorption. Die Eindringtiefe hängt von der Frequenz ab und sinkt mit steigender Frequenz: Sie verringert sich - gute Nachricht für die E-Netz-Teilnehmer - von 2,5 cm bei 900 MHz auf 1 cm bei 1800 MHz. Die relevante dosimetrische Größe in diesem Frequenzbereich ist die spezifische Absorptionsrate (SAR) mit der Einheit W/kg.
- Felder unter 1 MHz bewirken keine signifikante Erwärmung, können aber elektrische Ströme und Felder im Körper induzieren. Die relevante dosimetrische Größe in diesem Frequenzbereich ist daher die Stromdichte in A/m2. Die natürlichen Austauschprozesse im Körper führen im Gewebe zu 'Grundströmen' in der Größenordnung von 10 mA/m2; induzierte Stromdichten von über 100 mA/m2 können die Normalfunktion des Körpers beeinträchtigen und zu ungewollten Muskelkontraktionen führen.
Auf diese Weise lässt sich die tatsächliche Exposition (des Menschen an einem bestimmten Ort) in Beziehung zu den leichter messbaren Immissionswerten (an diesem Ort) setzen. Da elektrische Feldstärke (in V/m) und Leistungsflussdichte (in W/m2) in einer festen physikalischen Beziehung zueinander stehen und sich ineinander umrechnen lassen, ist die Angabe der Immissionsgrenzwerte sowohl in der einen als auch in der anderen Größe üblich.
Vermutungen und Entwarnungen
Die britische Independent Expert Group on Mobile Phones hat in ihrer Studie 'Mobile Phones and Health' einige zentrale Punkte der Diskussion um die Auswirkungen elektromagnetischer Felder von Handys zusammengefasst.Kanzerogenität: Das krebsauslösende Potenzial hochfrequenter elektromagnetischer Felder ist umstritten. Theoretisch lassen sich negative Einflüsse auf die DNA nicht begründen, da die Mobilfunkstrahlung nicht energiereich genug ist, um molekulare Bindungen auf direktem Wege aufzubrechen.
Einige Studien behaupten auf Grund von Tierversuchen, dass HF-Felder Tumore auslösen, die Wirkung bekannter kanzerogener Stoffe verstärken oder das Wachstum transplantierter Tumore beschleunigen können. Dies könnte auf die hohe Dosis der Exposition und thermische Effekte zurückzuführen sein.
Insgesamt gibt es keine Erkenntnisse aus In-vitro- und In-vivo-Experimenten, dass eine akute oder chronische Exposition mit HF-Feldern die Häufigkeit des Auftretens von Mutationen oder Chromosom-Veränderungen verstärkt, solange die Temperaturen im physiologischen Bereich bleiben.
Kalziumtransport: Kalziumionen signalisieren Zellen das An- und Abschalten von Genen und spielen eine wichtige Rolle bei der Zellteilung. Hochfrequenzfelder mit Intensitäten deutlich unterhalb von thermischen Wirkungen können den Transport von Kalzium und anderen Ionen durch die Membranen von Nervenzellen (Neuronen) beeinflussen. Solche Effekte wurden jedoch nur unter sehr speziellen Bedingungen beobachtet (Amplitudenmodulation mit 16 Hz), die für Mobilfunksysteme irrelevant sind.
Lebenserwartung: In Tierversuchen ist kein Einfluss von HF-Feldern auf die Lebenserwartung nachgewiesen worden.
Fortpflanzung: Versuche an Laborratten haben keinen Nachweis erbracht, dass mobilfunktypische HF-Felder den Fötus schädigen oder die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Herz-Kreislauf-System: Tierversuche rechtfertigen keine Bedenken etwaiger Auswirkungen auf Herz oder Kreislauf, solange die Intensität im mobilfunktypischen Bereich bleibt; beobachtete Effekte bei sehr hohen Intensitäten sind anscheinend auf die Erwärmung des Körpers zurückzuführen.
Hirnstrom-Aktivitäten und kognitive Funktionen: Kontrollierte Versuche mit menschlichen Probanden deuten darauf hin, dass die Exposition mit Mobilfunksignalen unterhalb der geltenden Intensitätsgrenzwerte biologische Effekte auslösen, die hinreichend stark sind, um das Verhalten zu beeinflussen. Der Ursache-Wirkungs-Mechanismus ist unklar. Langfrist-Effekte sind unbekannt; die bisherigen Untersuchungen beschränkten sich auf die Kurzzeit-Exposition. Tierversuche zeigten unspezifische, stress-ähnliche Veränderungen im Gehirn von Laborratten unter dem Einfluss von gepulsten HF-Feldern niedriger Intensität.
Gedächtnis und Lernfähigkeit: 'Es gibt keine konsistenten experimentellen Belege dafür, dass die Exposition mit HF-Feldern geringer Intensität Gedächtnis und Lernverhalten in Tieren beeinflusst. [...] Untersuchungen an menschlichen Probanden sind nötig, um einschätzen zu können, ob die Felder von Mobiltelefonen irgendeine Auswirkung auf die Lernfähigkeit und das Gedächtnis haben.'
Augen: Das Auge reagiert besonders empfindlich auf die Einwirkung elektromagnetischer Felder, weil es auf Grund der geringen Durchblutung induzierte Erwärmungen nur schwer abführen kann; schon kleinere Schädigungen können irreversibel sein und sich aufsummieren. Augenreizungen und Linsentrübungen ('grauer Star') sind in Tierversuchen nachgewiesen worden, dies allerdings bei deutlich höheren Belastungen als sie von einem Handy ausgehen. Versuche an Primaten zeigen, dass gepulste HF-Felder auch niedriger Intensität das Auge schädigen können. 'Die Studien geben Anlass zu ernsthafter Besorgnis über mögliche Beeinträchtigungen des Auges durch gepulste HF-Felder mit hohen Spitzenleistungen.'
Melatoninhaushalt: Melatonin ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus bei Mensch und Tier steuert; des Weiteren schützt es die genetische Information der Zellen vor Schädigungen. Im Zusammenhang mit niederfrequenten Feldern im Umfeld von Hochspannungsleitungen behauptet die Melatonin-Hypothese einen Einfluss auf die Tumorentstehung, der jedoch nicht abschließend geklärt ist. Es gibt nur wenige Untersuchungen zum Einfluss von hochfrequenten Feldern auf die Melatoninproduktion; sie haben den Verdacht nicht erhärtet.
Blut-Hirn-Schranke: Die Blut-Hirn-Schranke ist ein Filter, das verhindert, dass große Moleküle aus der Blutbahn in die Gehirnflüssigkeit gelangen. Die Erkenntnisse zu einer Beeinträchtigung der Filterwirkung durch HF-Exposition sind inkonsistent und widersprüchlich; jüngere Arbeiten haben keinen Effekt nachgewiesen.
Gerangel um Grenzwerte
Seit Italien und die Schweiz aus dem internationalen Konsens ausscherten und unter Berufung auf das Vorsorgeprinzip die zulässigen Emissionen von Basisstationen deutlich niedriger als die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutz-Kommission für Nicht-Ionisierende Strahlen (ICNIRP) begrenzten, befürchten die Mobilfunkbetreiber, dass nun ein Wettlauf um die niedrigsten Immissionsstandards einsetzt.Italien hatte 1998 die Grenzwerte auf ein Hundertstel der ICNIRP-Empfehlungen herabgesetzt; in der Schweiz sind seit dem 1. Februar in Wohngegenden sowie im Umfeld von Schulen und Krankenhäusern nur noch elektrische Feldstärken von höchstens 4 V/m für GSM-900-Antennen und 6 V/m für DCS1800-Basisstationen zulässig. Die neue Verordnung über den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung zwingt die Betreiber, in dicht besiedelten Gebieten die Funkzellen zu verkleinern und mehr Basisstationen mit kleinerer Leistung aufzustellen. Im Fall der eidgenössischen Republik werden die zusätzlichen Kosten auf eine Milliarde Schweizer Franken geschätzt.
Grenzwerte sind der klassische Schauplatz, auf dem über die Akzeptanz oder Zumutung kollektiver Risiken gerungen wird. In der Bundesrepublik war der Wechsel von der DIN/VDE-Norm 0848 zu den schärferen ICNIRP-Richtlinien vor allem auf die jahrelange Kritik zurückzuführen, dass zuvor eher die Vertreter der einschlägigen Industrie als unabhängige Fachwissenschaftler im Kleingedruckten der Mess- und Bewertungsverfahren den Ton angaben. Ob hormonähnliche Substanzen im Trinkwasser oder Pestizid-Rückstände in Lebensmitteln - das Setzen von Umweltstandards ist immer dann besonders heftig umstritten, wenn es mit einer rechtlichen Güterabwägung zwischen ungewissen Folgewirkungen (dem 'Ignoranzrisiko') und den konkret greifbaren Folgekosten einer Immissionsreduzierung verbunden ist.
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat die EU-Kommission deshalb im Februar eine Empfehlung vorgelegt, die Kriterien für die Anwendung des Vorsorgegedankens aufstellt. Dazu gehört unter anderem die Verhältnismäßigkeit: Grenzwerte sollten 'nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzniveau stehen und nicht auf ein 'Null-Risiko' abzielen, das sich nur selten verwirklichen lässt'. Sie sollen sich auf Kosten/Nutzen-Analysen des Tätigwerdens oder Unterlassens stützen und stets unter dem Vorbehalt der Überprüfung durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse stehen.
Als weiteren Grundsatz zur Festlegung rechtlicher Eingriffsschwellen fordert die EU-Kommission 'Kohärenz': 'Lässt sich das Risiko wegen fehlender wissenschaftlicher Daten und in Anbetracht bewertungsinhärenter Unklarheiten nicht beschreiben, so müssen die getroffenen Vorsorgemaßnahmen anderen Maßnahmen, die in ähnlichen Bereichen getroffen wurden, in denen alle erforderlichen wissenschaftlichen Daten vorliegen, inhaltlich entsprechen und von gleicher Tragweite sein.'
Im Klartext: Das Risiko des Nichtwissens hat sich an bekannten, aber akzeptierten Risiken in anderen Lebensbereichen zu messen. Solcherart Kohärenz-Check hat freilich seine Tücken, denn wo sucht man den Bezugspunkt des Vergleichs - beim motorisierten Individualverkehr (1999: 7749 Tote) oder der Wahrscheinlichkeit, beim Spaziergang im Stadtpark von einem herabfallenden Ast erschlagen zu werden?
| © 2000-2026 Weisser |
| Impressum |